
Prof. Dr. Jens Schröter nimmt Teil am Herrenhäuser Forum zu Industrie 4.0
Am 30.11. nimmt Prof. Dr. Jens Schröter als Sprecher des VW-Forschungsprojekts "Die Gesellschaft nach dem Geld" teil am Herrenhäuser Forum "Industrie 4.0". Hier geht es zur Zusammenfassung zum Mithören auf NDR Info.
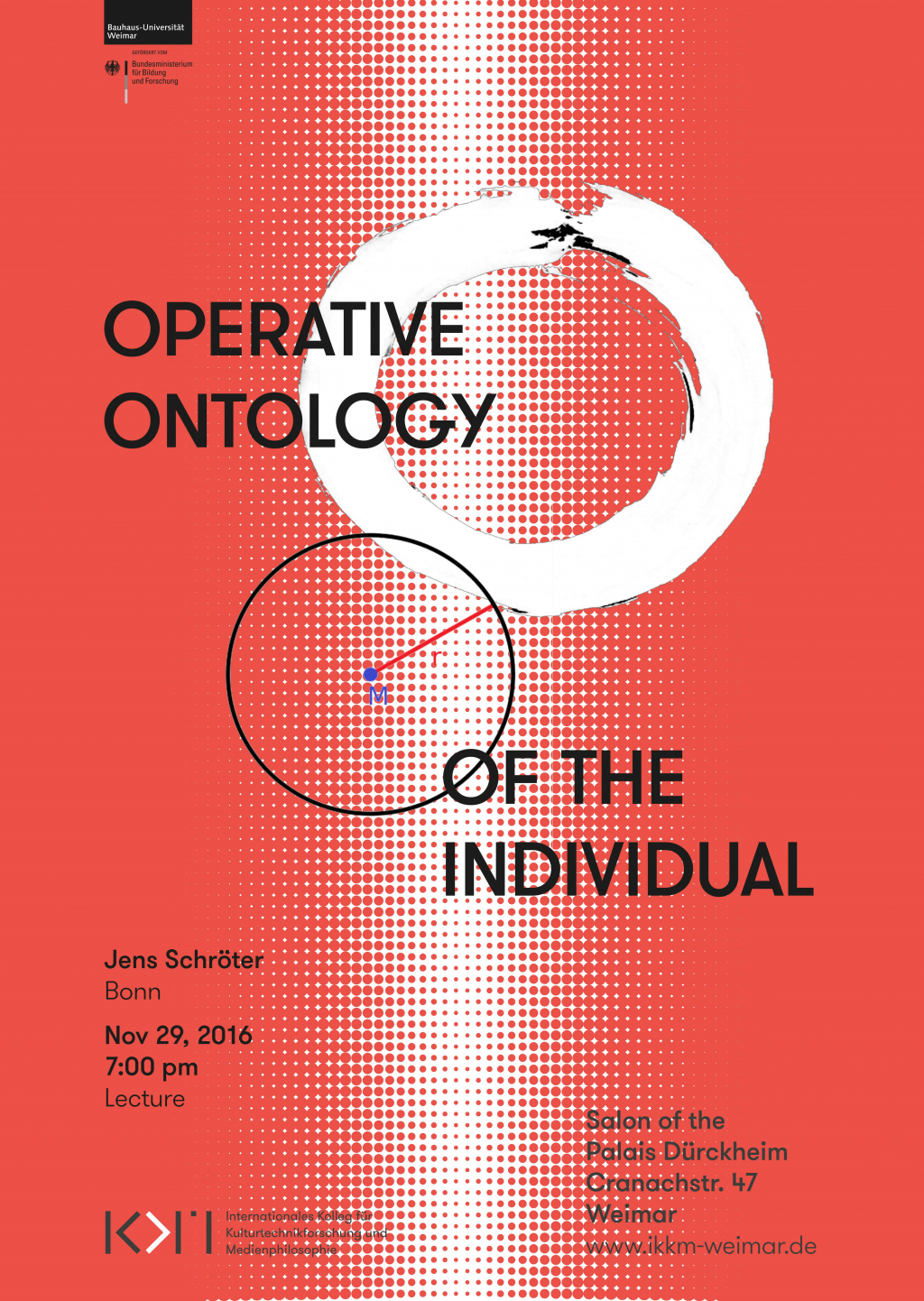
The Operative Ontology of the Individual
Vortrag von Prof. Dr. Jens Schröter am IKKM, Weimar, 29.11.2017, 19 Uhr, Salon, Palais Dürckheim, Cranachstr. 47, Weimar
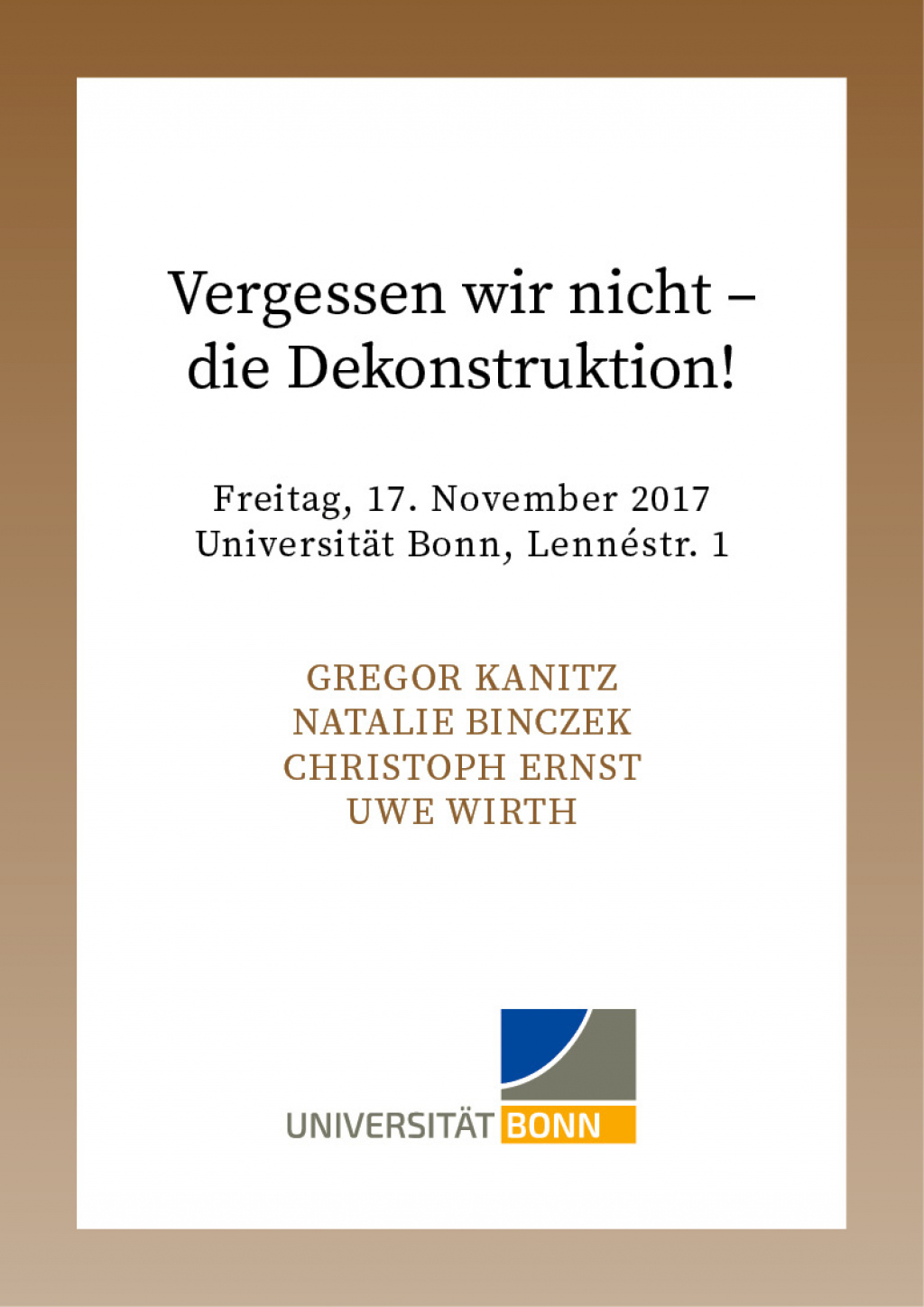

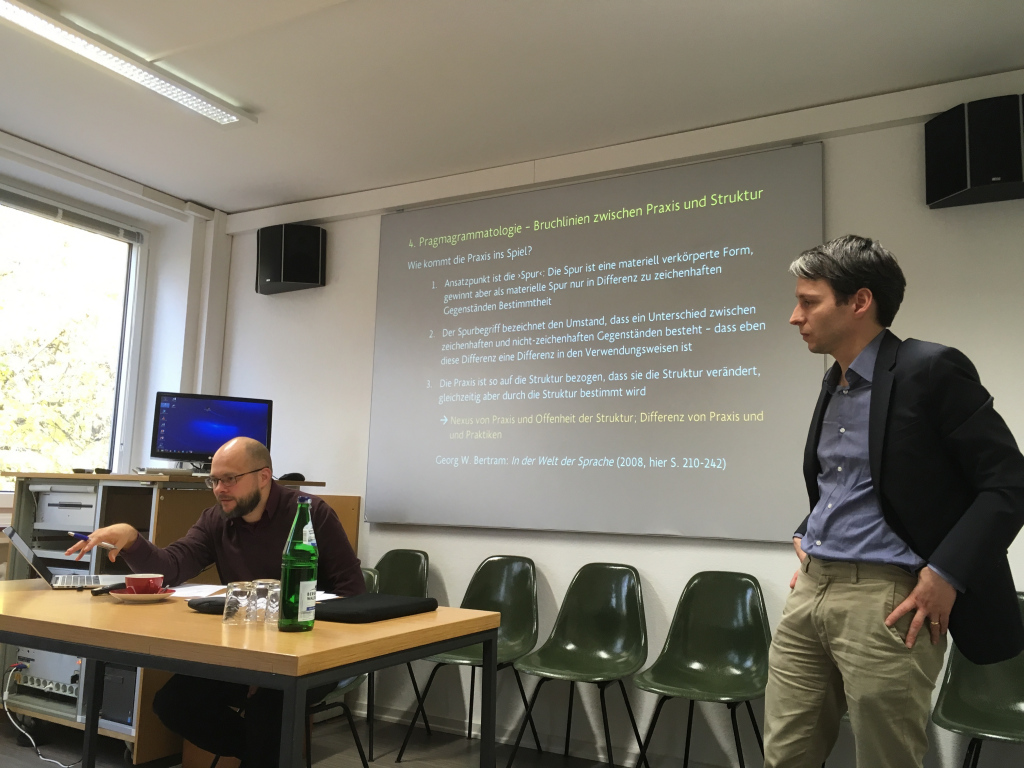


Vergessen wir nicht – die Dekonstruktion!
17. November 2017, Universität Bonn
Im Jahr 1967 veröffentlichte Jacques Derrida bei drei angesehenen Pariser Verlagen drei Bücher – De la grammatologie, L’écriture et la différence und La voix et le phénomène –, in denen er eine neue Art und Weise philosophischer Textarbeit vorstellte: Dekonstruktion. Das von Derrida propagierte »nicht abschließbare und nicht vollständig formalisierbare Ensemble von Regeln des Lesens, Interpretierens und Schreibens« (wie er selbst es einmal nannte) sollte sich als ungeheuer erfolgreich erweisen. Vermittelt vor allem über die Rezeption Derridas in der US-amerikanischen Literaturwissenschaft wurden dekonstruktive Lektüren und Interpretationen bald zum unverzichtbaren Instrument im analytischen Werkzeugkasten der Geistes- und Kulturwissenschaften. Gerade auch die Genese des jüngeren medienwissenschaftlichen Denkens ist ohne den Einfluss Derridas nicht vorstellbar, gab dessen Fundamentalkritik an Konzepten wie ›Zeichen‹, ›Sprache‹ und ›Schrift‹ den Autorinnen und Autoren der ersten Stunde doch entscheidende theoretische Anstöße. Seit geraumer Zeit jedoch ist in medienwissenschaftlichen Debatten kaum noch die Rede von Derrida. Dekonstruktion scheint sich als Projekt intellektuell wie politisch erledigt zu haben. Die heutige Generation der Studentinnen und Studenten erfährt davon, wenn überhaupt, eher am Rande oder aus Einführungs- und Überblickswerken. Angesichts der derzeitigen diskursiven Abwesenheit der Dekonstruktion (einer vielleicht gespenstischen Abwesenheit, die Platz für Heimsuchungen lässt), nehmen wir das fünfzigjährige Jubiläum von Derridas annus mirabilis 1967 zum Anlass, uns an den Anfang der Dekonstruktion und an die Neuanfänge, die sie dem Denken ermöglicht hat, zu erinnern.
Es referieren Gregor Kanitz, Natalie Binczek, Christoph Ernst und Uwe Wirth.
Um Anmeldung wird gebeten.
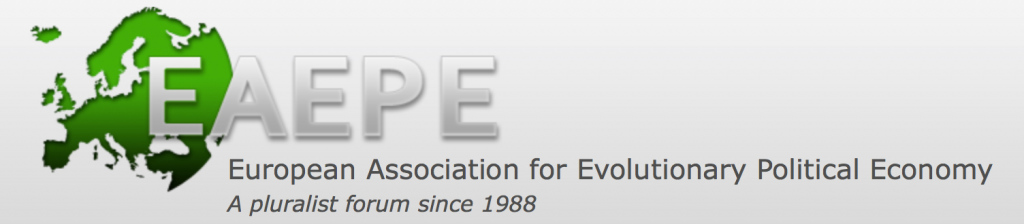
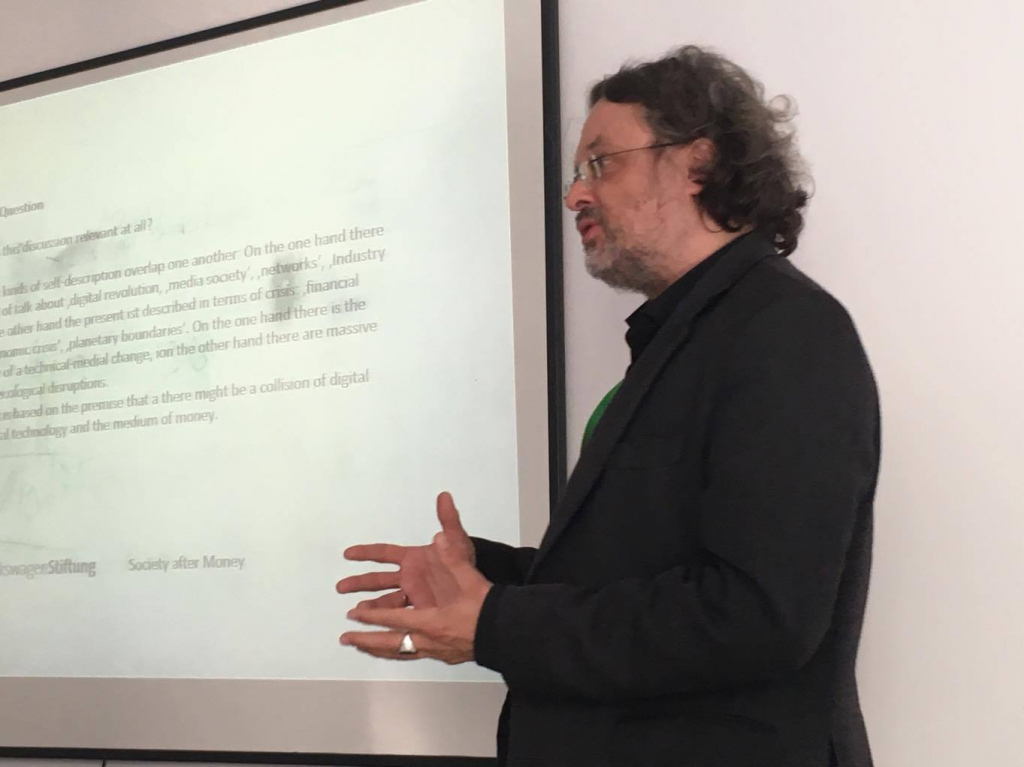
Vortrag von Prof. Dr. Jens Schröter auf der EAEPE-Jahrestagung in Budapest!
Am 20.10. hielt Jens Schröter auf der Jahrestagung der EAEPE (European Association for Evolutionary Political Economy) in Budapest einen Vortrag über das VW-Projekt "Die Gesellschaft nach dem Geld".
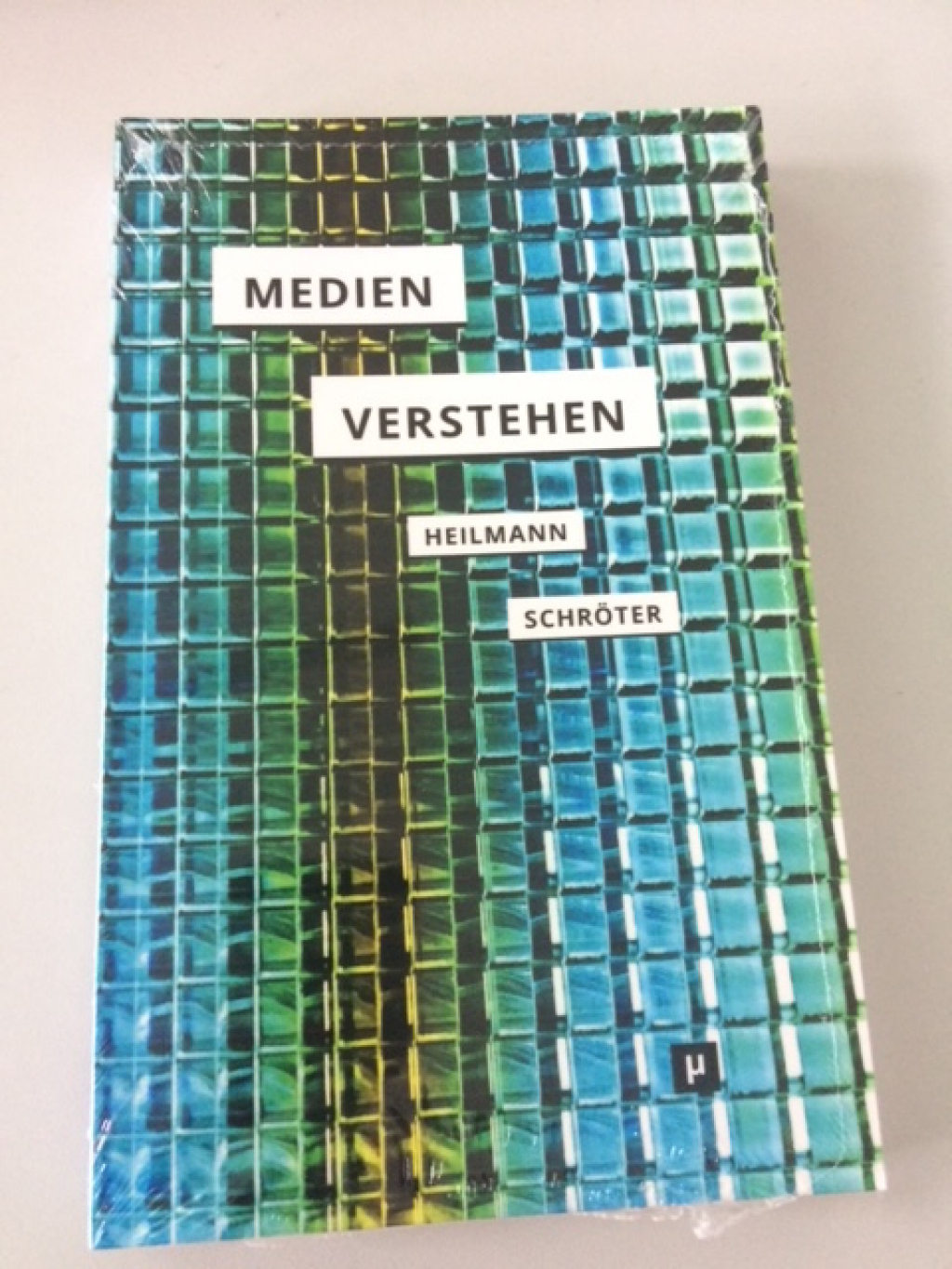
Medien verstehen
Till A. Heilmann/Jens Schröter (Hg.)
1964 erschien bei McGraw-Hill in New York das Buch Understanding Media. The Extensions of Man des kanadischen Literaturwissenschaftlers Marshall McLuhan. Das 50-jährige Jubiläum der Erstpublikation bot 2014 Anlass, sich eingehender mit dem von McLuhan skizzierten Pro- gramm einer allgemeinen Medienwissenschaft auseinanderzusetzen. Ist McLuhans Buch dafür bloß von historischem Interesse? Oder kann man mit Understanding Media heute (noch) Medien verstehen? Wie soll man sich in der medienwissenschaftlichen Forschung auf dieses umstrittene Gründungsdokument der Disziplin beziehen? Die Ergebnisse der Tagung liegen jetzt publiziert vor. Hier geht es zum Volltext

Jens Schröter ist im WS 2017/18 Senior Fellow am IKKM Weimar!
Prof. Dr. Jens Schröter wird im WS 2017/18 in Weimar am IKKM sein und an seinem Forschungsprojekt "Die operative Ontologie des Individuums" arbeiten.


