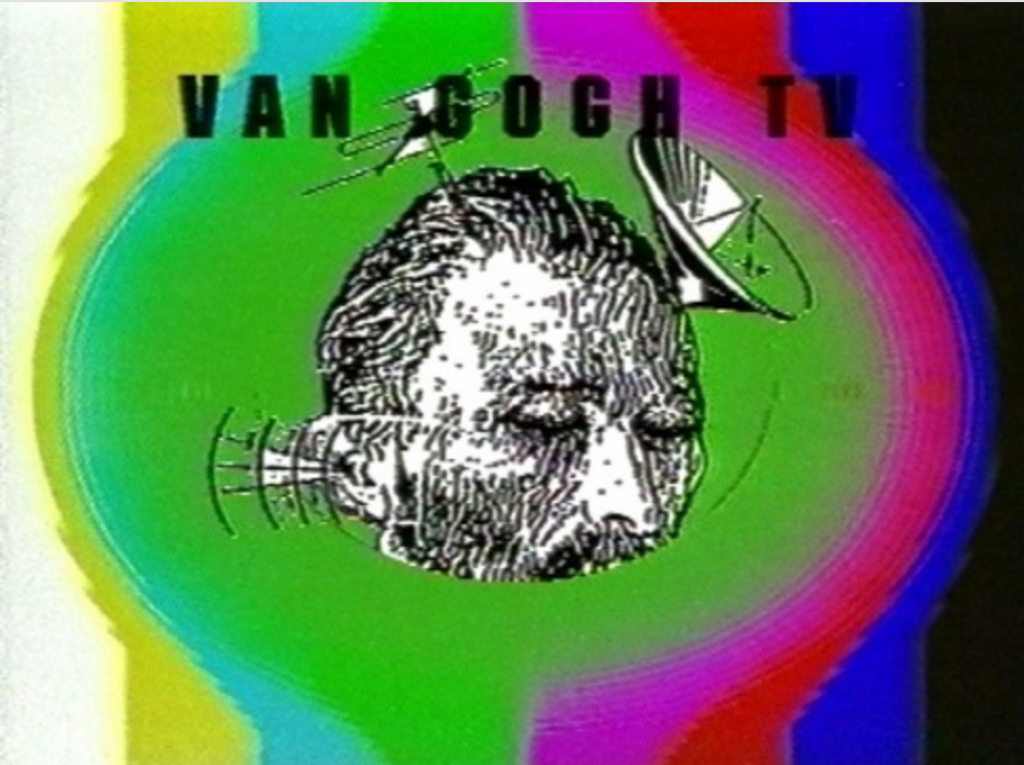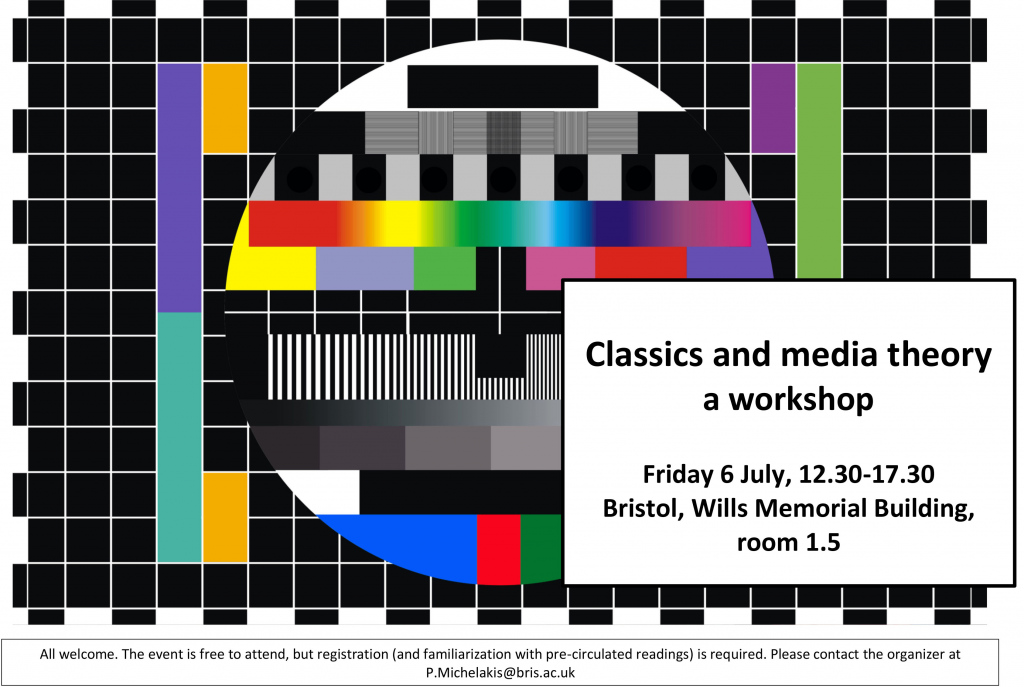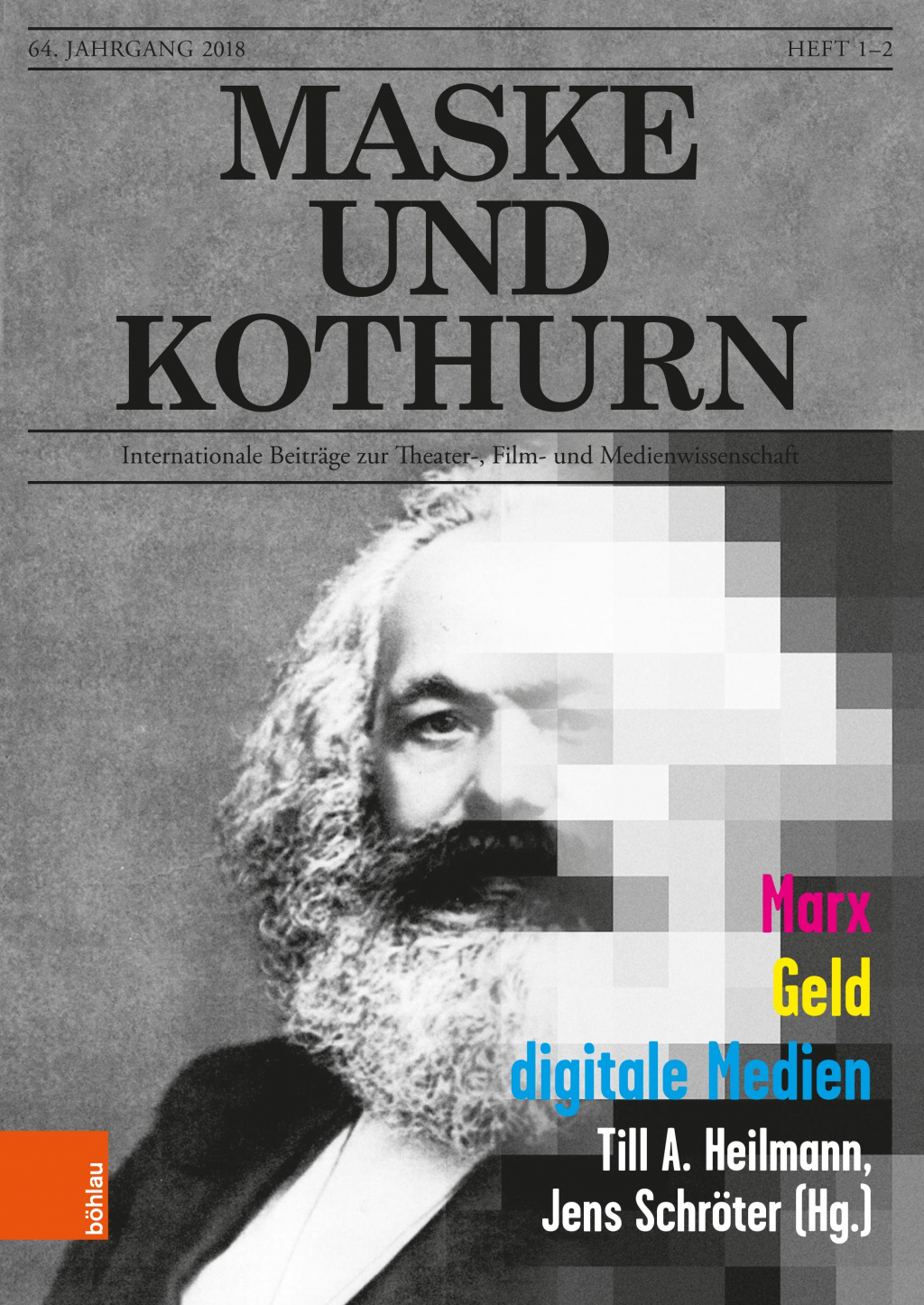
Marx - Geld - Digitale Medien
Till A. Heilmann und Jens Schröter (Hrsg.)
JETZT ERSCHIENEN! Till A. Heilmann/Jens Schröter (Hrsg.): Marx - Geld - Digitale Medien, Doppelheft, 64/1-2, 2018, von Maske & Kothurn.
Den Ausgangspunkt des Heftes bilden zwei Beobachtungen. Erstens gibt es spätestens seit der Finanzkrise ab 2007 sowohl in der Öffentlichkeit wie auch in der Wissenschaft wieder ein vermehrtes Interesse an der Analyse und Kritik der kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung durch Karl Marx: Zu offensichtlich sind die ökonomischen Krisensymptome und ihre vielfältigen politischen, sozialen und kulturellen Auswirkungen. Zweitens scheinen die anhaltende Proliferation von vernetzter Digitaltechnik (Stichworte: Mobilkommunikation, Internet der Dinge, Ubiquitous Computing usw.) und die fortschreitende computergestützte Programmierung bzw. Algorithmierung von Prozessen aller Art auch Bereiche in die ökonomische Verwertung einzubeziehen, die dieser bislang fremd oder verschlossen waren (siehe etwa die sogenannte Sharing Economy mit Diensten wie Uber oder AirBnB). Beides, die akute Krisenhaftigkeit des Kapitalismus wie seine ungebrochene subsumierende Kraft, fordern zu einer eingehenderen Betrachtung auf. Dabei müssen die ökonomischen und die technologischen Dimensionen des Gegenstandes selbstredend gleichermaßen und in ihrer gegenseitigen Verschränkung berücksichtigt werden. Denn offensichtlich ist die kapitalistische Produktionsweise nicht nur durch die Anwendung technischer Arbeitsmittel oder Produktivkräfte im landläufigen bzw. engeren Sinne gegeben (d. h. durch die Maschinen, mit denen Güter hergestellt werden), sondern auch durch den Einsatz von Medien unterschiedlicher Art wie Uhren, Telekommunikationsnetzwerken oder Datenspeichern, nicht zuletzt aber durch die Angewiesenheit auf das allgemeine Medium Geld. Damit bietet sich der Analyse zugleich die Chance, einseitigen Auffassungen der jeweiligen Gegenstandsbereiche – also einem schlichten Ökonomismus oder Technizismus – zu entkommen und verkürzte Lesarten der Marx’schen Analyse des Kapitalismus einerseits und gängiger Medien- und Techniktheorien andererseits zu vermeiden. Das Heft soll einen Beitrag zur Diagnose des gegenwärtigen ‚digitalen‘ Kapitalismus liefern, indem die Arbeiten von Marx (aber auch Beiträge kritischer Theorietraditionen) vor dem Hintergrund neuer medien- und techniktheoretischer Ansätze und vice versa diskutiert werden.
Hier kann das Heft bestellt werden.

Medienindustrien
Florian Krauß/Skadi Loist (Hg.)
Die ab Heft 1/2015 von Prof. Dr. Jens Schröter als Hauptherausgeber zusammen mit dem Graduiertenkolleg "Locating Media" (Universität Siegen) und JProf. Benjamin Beil (Universität zu Köln) herausgegebene kultur- und medienwissenschaftliche Zeitschrift „Navigationen“ widmet sich in ihrer aktuellen Ausgabe (2/2018) dem Thema "Medienindustrien".
Medienindustrien rücken in der deutschsprachigen Medienwissenschaft verstärkt in den Mittelpunkt. Workshop- und Konferenzthemen, Forschungsprojekte sowie Verzahnungen mit Media Industry Studies in weiteren Sprachräumen und Ländern sind deutliche Indizien. Steht nun auch für den deutschsprachigen Forschungskontext der "industry turn" bevor?
Zumindest greift die Einschätzung zu kurz, dass Medienindustrie- und Produktionsforschungen allein in der angloamerikanischen Welt stattfinden. Der Navigationen-Band führt aktuelle Arbeiten aus der deutschsprachigen Medienwissenschaft zusammen und geht so eine Lücke an, gegen die die AG Medienindustrien seit ihrer Gründung 2012 anarbeitet. Mit Beiträgen von Wissenschaftler*innen der AG Medienindustrien präsentiert die Publikation Schwerpunkte wie die deutsche Fernsehindustrie und Serienproduktion, Filmvermarktung, Filmfestivals, Games und Radio. Neben historischen Perspektiven geht es auch um aktuelle Diskussionen zu Gender-Hierarchien.
Navigationen 2 (2018): MEDIA INDUSTRIES: Current Perspectives from German-speaking Media Studies
Media industries increasingly move to the center of attention in German-speaking Media Studies. Workshop and conference themes, research projects and links to the international field of Media Industry Studies are clear indicators. Are we on the brink of an “industry turn” in the German-speaking research context?
The previous assessment that Media Industry and Production Studies research is only be an Anglo-American phenomenon seems to be outdated. This Navigationen issue collects recent work from German-speaking Media Studies and aims to close a gap, which the Media Industries workgroup of the German Media Studies association (Gesellschaft für Medienwissenschaft) has been working against since its inception in 2012. Including articles by workgroup members, the volume presents research areas such as the German television industry and its serial drama production, film marketing, film festivals, games and radio. Along with historical perspectives, current debates on gender equality are also raised.
Navigationen – Zeitschrift für Medien und Kulturwissenschaften, Vol. 18 (2018), Issue 2
MEDIENINDUSTRIEN. Aktuelle Perspektiven aus der deutschsprachigen Medienwissenschaft
Florian Krauß / Skadi Loist (Eds.)
Siegen: universi 2018, 199 pg.
ISSN 1619-1641
Price: 13,- Euro

Gastvortrag Dr. Sebastian Gießmann
Elemente einer Praxistheorie der Medien
Im Rahmen der Vorlesung Einführung die Medienwissenschaft (Prof. Dr. Jens Schröter) im WS hält Dr. Sebastian Gießmann (Siegen) am 28.11., 10-12, L6 4.001 einen Vortrag mit dem Titel Elemente einer Praxistheorie der Medien, in dem er seinen gleichnamigen, programmatischen Artikel aus der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift für Medienwissenschaft vorstellt (hier geht es zur Online-Ausgabe der ZfM) und mit uns diskutieren will.

Navigationen jetzt im media/rep!
Das durch ein, von Prof. Dr. Malte Hagener geleitetes, DFG-Projekt begründete Medienwissenschaftliche Repositorium ist jetzt online und schließt u.a. die von Prof. Dr. Schröter, JProf. Dr. Benjamin Beil, Köln, und dem Graduiertenkolleg Locating Media in Siegen herausgegebene Zeitschrift Navigationen ein.
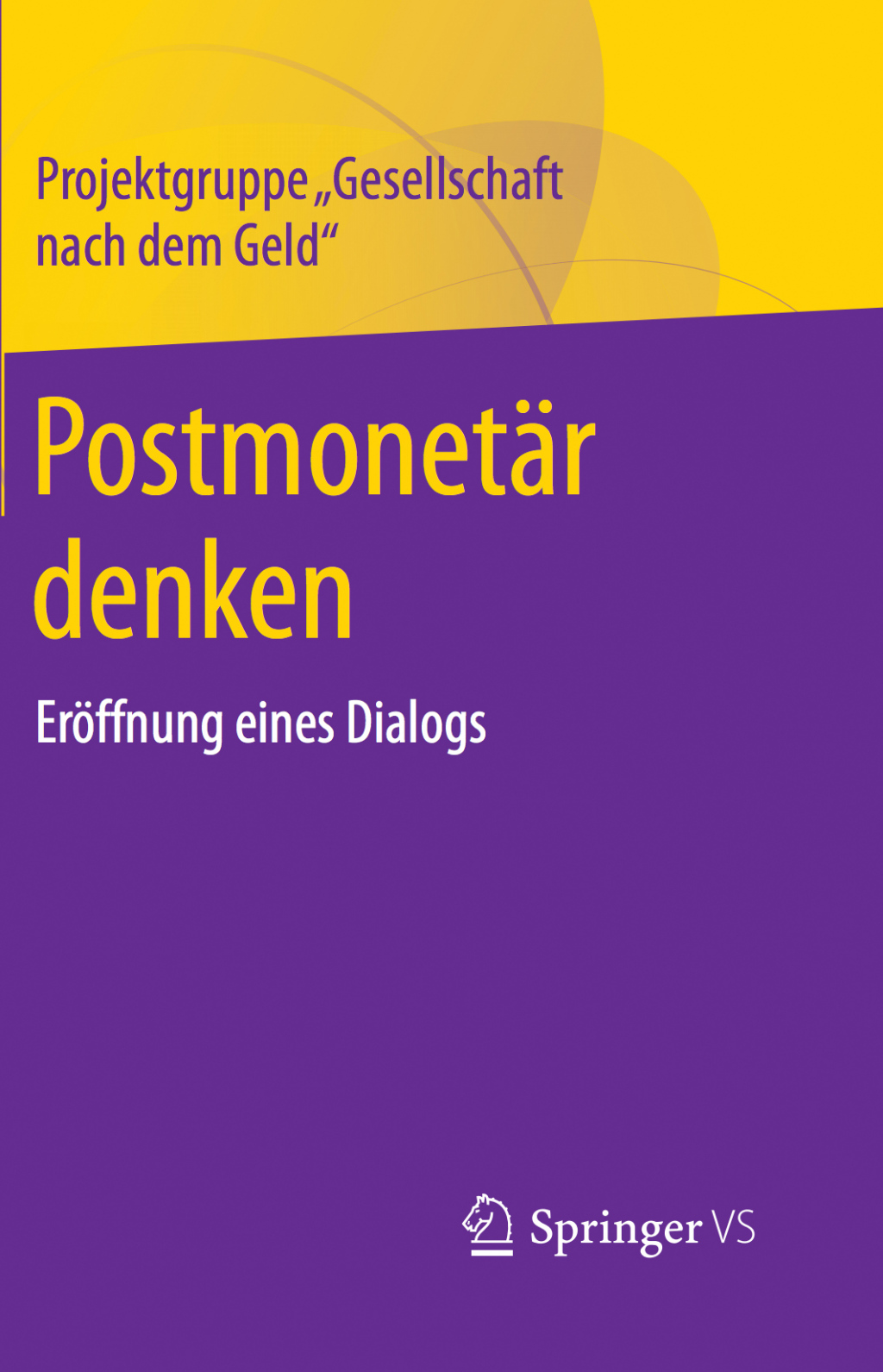
Postmonetär denken
Projektgruppe Gesellschaft nach dem Geld
Alles dreht sich ums Geld. Keine irgendwie geartete individuelle oder kollektive Praxis, keine technologische oder wissenschaftliche Entwicklung scheint ohne Geld denkbar zu sein. Seit langer Zeit wird Geld aber auch kritisiert, doch der Gedanke an eine ‚Gesellschaft nach dem Geld‘ löst Widerstand und Befremden aus. In dem Sammelband treten zum einen heterogene Wissensbereiche in einen Dialog und beleuchten ihre Theorien und Kritiken des Geldes wechselseitig. Zum anderen wird ergebnisoffen über die Möglichkeit post-monetärer Organisations- und Produktionsformen nachgedacht.
Das Buch ist das Ergebnis intensiver Diskussionen in dem VW Projekt: Die Gesellschaft nach dem Geld, was ab dem 1.11.2018 in seine zweite vierjährige Phase geht. Die Projektergebnisse aus der ersten Phase erscheinen 2019 auch in Englisch bei Bloomsbury in den USA.
Hier geht es zur Ankündigung bei Springer,