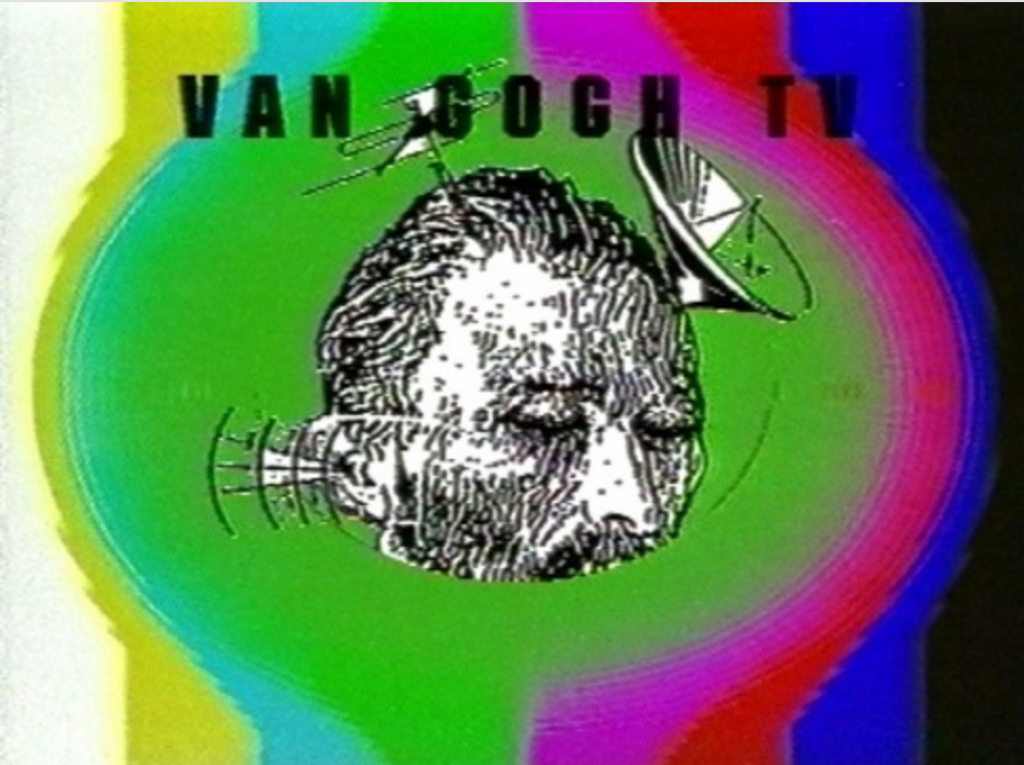Immersion. Grenzen und Metaphorik des digitalen Subjekts
Thiemo Breyer, Dawid Kasprowicz (Hrsg.)
Die ab Heft 1/2015 von Prof. Dr. Jens Schröter als Hauptherausgeber zusammen mit dem Graduiertenkolleg "Locating Media" (Universität Siegen) und JProf. Benjamin Beil (Universität zu Köln) herausgegebene kultur- und medienwissenschaftliche Zeitschrift „Navigationen“ widmet sich in ihrer aktuellen Ausgabe (1/2019) dem Thema "Immersion. Grenzen und Metaphorik des digitalen Subjekts".
Von der Verschränkung unseres Alltags mit digitalen Medien bis hin zum Erlebniswert technischresponsiver Räume über das Attunement atmosphärisch gestimmter Arbeitsplätze: All diese Formen der Einbettung oder des Eintauchens in mediatisierte Umwelten finden ihre Bezeichnung als
Immersion. Die Immersion ist dabei aber weder für digitale noch für artifizielle Umwelten reserviert. Sie stellt vielmehr eine Medienpraxis für die Konstruktion von Subjektivität und dessen Grenzen dar. Subjektivität ist damit unter Bedingungen der Immersion eben keine Auflösungs- oder Täuschungsfigur. Denn so heterogen das Verfahren der Immersion auch sein mag, so zielt es doch auf die Frage nach neuen Bestimmungen des Selbst, des Körpers sowie der Emotionen und nicht zuletzt den jeweils neu gesetzten Abgrenzungen zur Umwelt ab.
Die Beiträge in diesem Heft versammeln solche Verfahren der Immersion anhand von Phänomenen wie dem Affekt, der Musik, der Leiblichkeit, der Animation, dem kollektiven Gedenken oder der kinematographischen Projektion.
Schlagworte:
Illusion, Affekt, Emotion, Körper, Umwelt, Milieu

Vortrag von PD Dr. Christoph Ernst und Prof. Dr. Jens Schröter an der École normale supérieure!
Closure as Folding – Imagining Hyperobjects in Liu Cixins Trilogy Remembrance of Earth’s Past
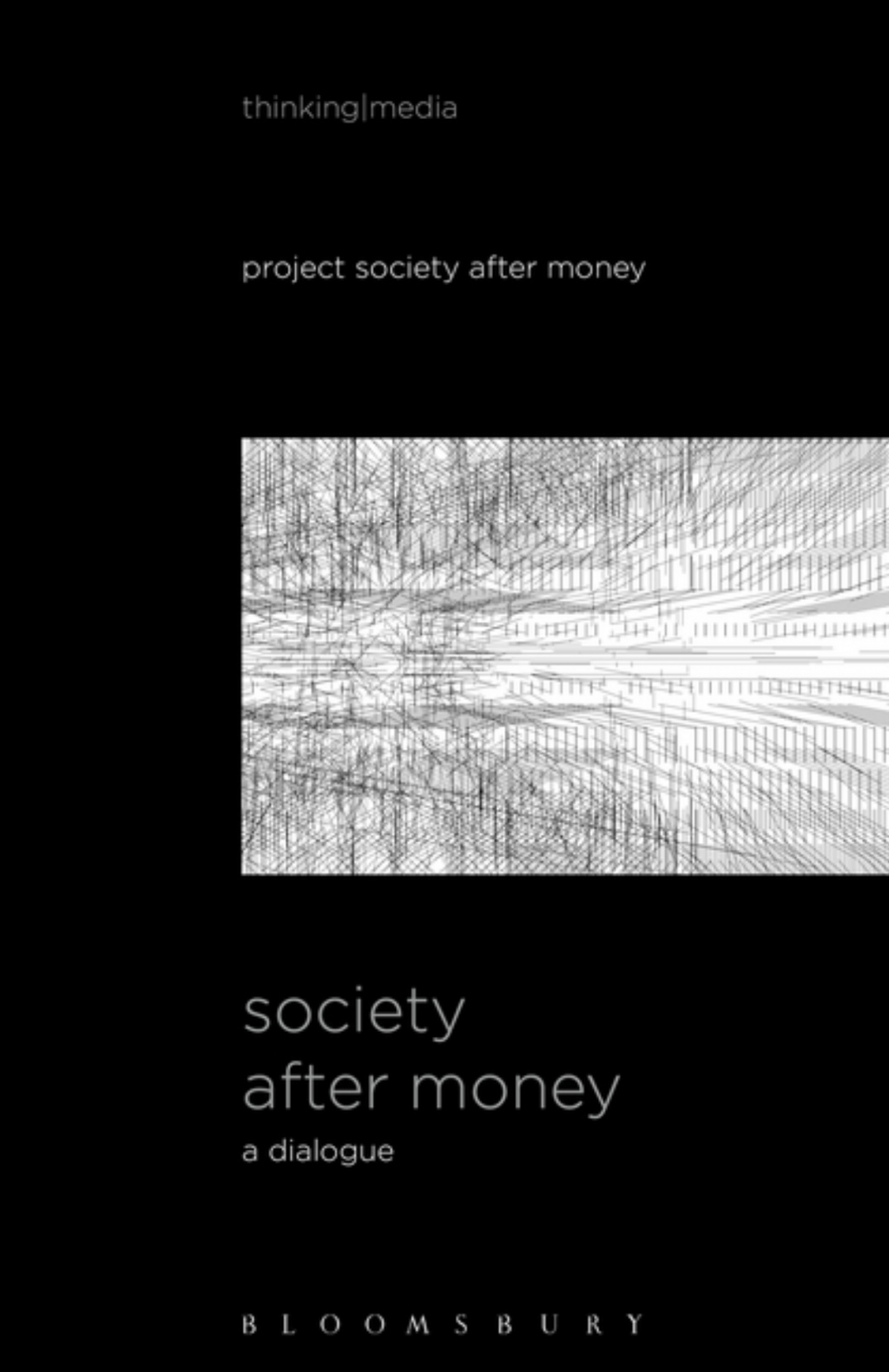
Society after Money: A Dialogue
Project Society after Money
Project Society After Money is an interdisciplinary project between commons theory, evolutionary political economy, media studies and sociology, that enter into a dialogue with one another in order to look at their specific theories and criticisms of money. Conceived as the beginning of a necessary interdisciplinary dialogue, the possibilities of post-monetary forms of organization and production are taken into account and examined. On one hand there is a lot of talk about digital revolution, mediatized society, networks, Industry 4.0. On the other hand the present is described in terms of crisis: financial crisis, economic crisis, planetary boundaries. At once there is the description of a media-technological change along with massive social and ecological disruptions.
Society After Money is based on the premise that there might be a conflict between digital media/digital technology and the medium of money – and perhaps new digital possibilities that allow alternative forms of economy. It criticizes what is normally seen as self-evident and natural, namely that social coordination has to be done by the medium of money. Were left with a highly innovative collection of contributions that initiates a broader social discourse on the role of money in the global society of the 21st century.
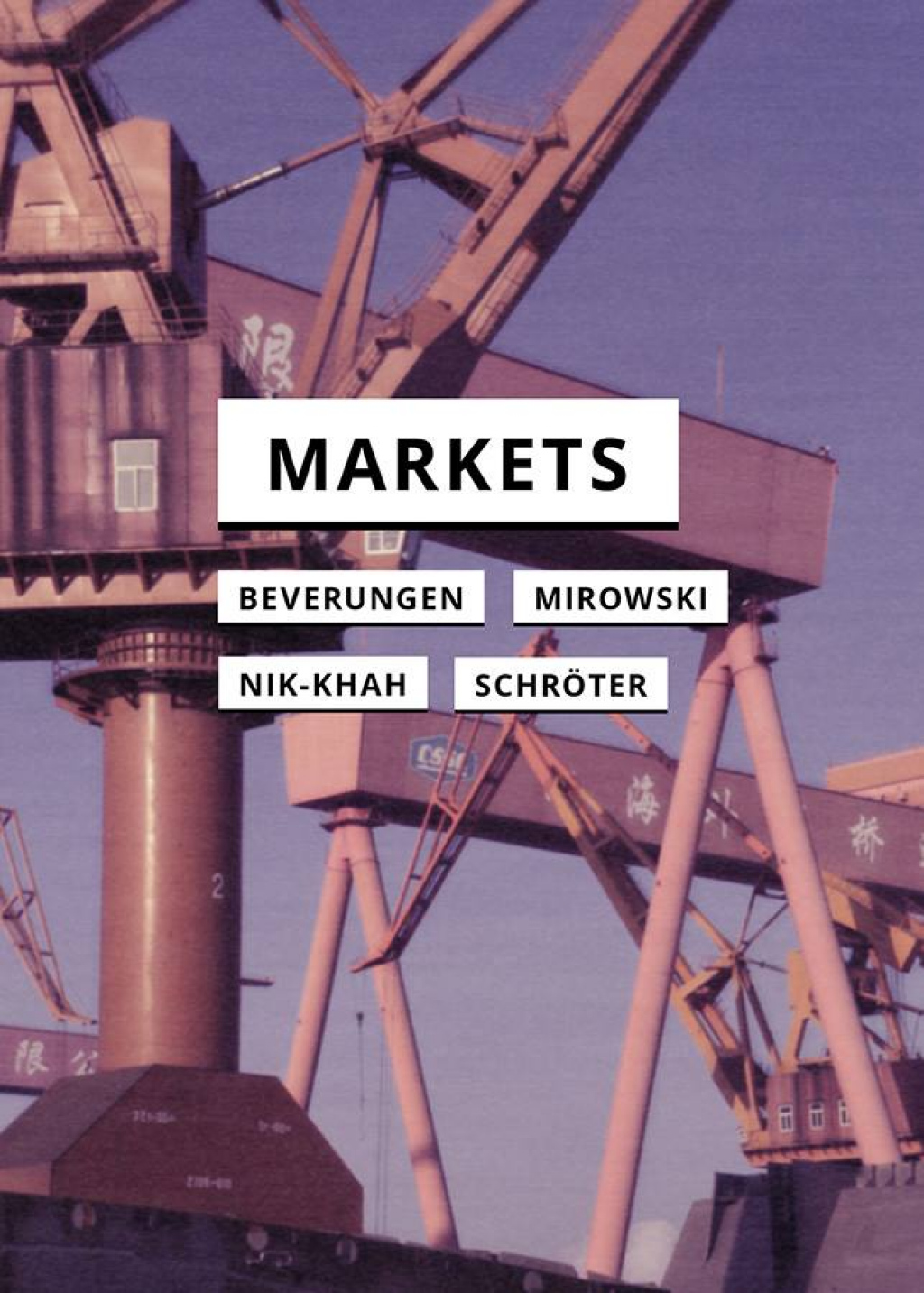
In Search of Media: Markets
Armin Beverungen, Philip Mirowski, Edward Nik-Khah, Jens Schröter
In Search of Media #2 is now freely available: "Markets" by Armin Beverungen, Philip Mirowski, Edward Nik-Kah, and Jens Schroeter
https://meson.press/books/markets/
(Bei meson ist der Volltext als .pdf verfügbar)
https://www.upress.umn.edu/book-division/books/markets
“One of the great deficiencies of media theory has been an adequate account of markets. As new technologies evolve to secure the most recent gains in wealth accumulation, this collection shows what is at stake in overlooking or accepting the very first principles of capitalism.”
- Melissa Gregg, Research Director at Intel
“The technological media and infrastructures of markets and finance capitalism should be of utmost concern to cultural theory. In bringing together the critical history of economic thought and the media theory of money and markets, this book is a compelling and timely intervention.“
- Joseph Vogl, Humboldt University, Berlin / Princeton University
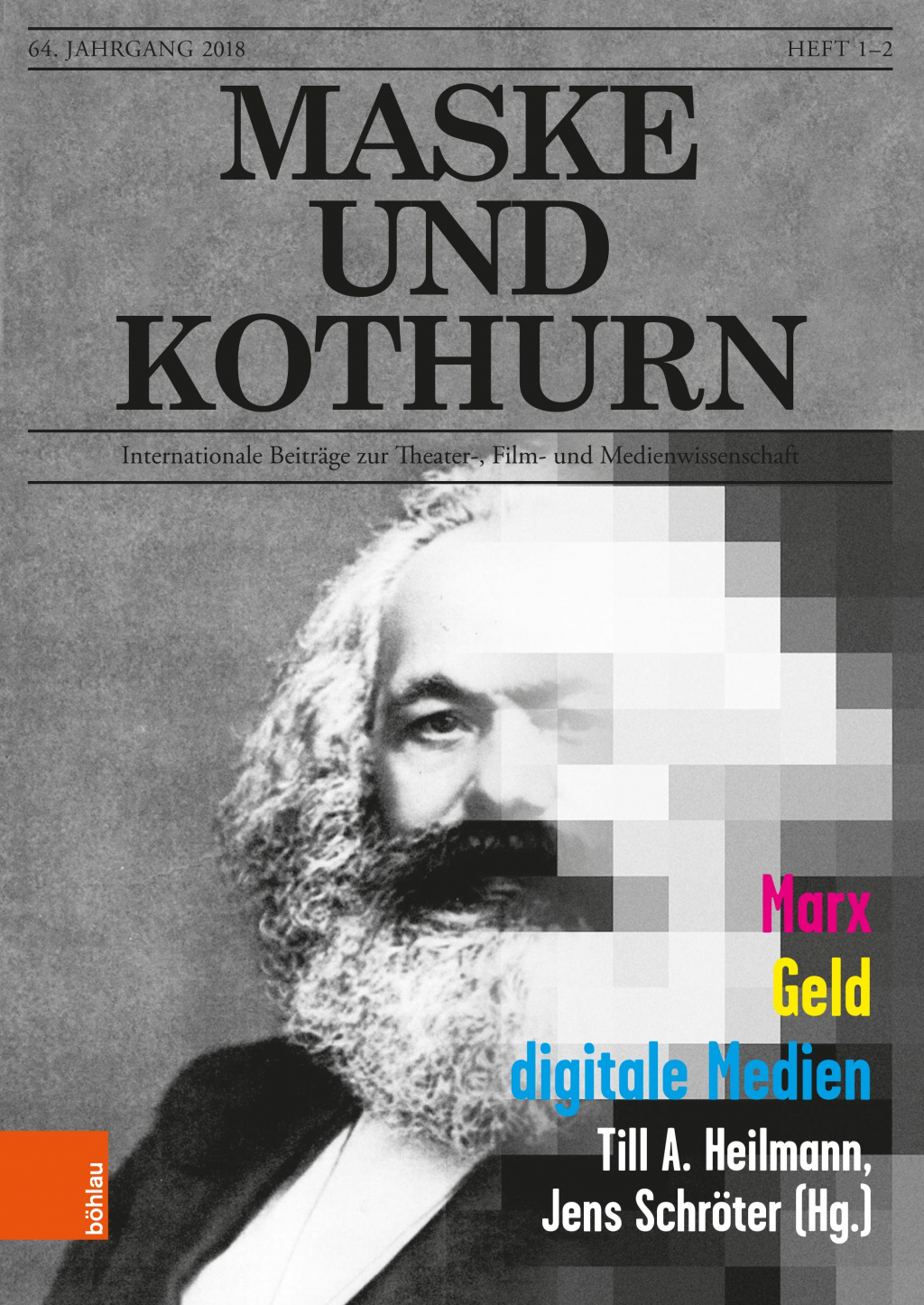
Marx - Geld - Digitale Medien
Till A. Heilmann und Jens Schröter (Hrsg.)
JETZT ERSCHIENEN! Till A. Heilmann/Jens Schröter (Hrsg.): Marx - Geld - Digitale Medien, Doppelheft, 64/1-2, 2018, von Maske & Kothurn.
Den Ausgangspunkt des Heftes bilden zwei Beobachtungen. Erstens gibt es spätestens seit der Finanzkrise ab 2007 sowohl in der Öffentlichkeit wie auch in der Wissenschaft wieder ein vermehrtes Interesse an der Analyse und Kritik der kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung durch Karl Marx: Zu offensichtlich sind die ökonomischen Krisensymptome und ihre vielfältigen politischen, sozialen und kulturellen Auswirkungen. Zweitens scheinen die anhaltende Proliferation von vernetzter Digitaltechnik (Stichworte: Mobilkommunikation, Internet der Dinge, Ubiquitous Computing usw.) und die fortschreitende computergestützte Programmierung bzw. Algorithmierung von Prozessen aller Art auch Bereiche in die ökonomische Verwertung einzubeziehen, die dieser bislang fremd oder verschlossen waren (siehe etwa die sogenannte Sharing Economy mit Diensten wie Uber oder AirBnB). Beides, die akute Krisenhaftigkeit des Kapitalismus wie seine ungebrochene subsumierende Kraft, fordern zu einer eingehenderen Betrachtung auf. Dabei müssen die ökonomischen und die technologischen Dimensionen des Gegenstandes selbstredend gleichermaßen und in ihrer gegenseitigen Verschränkung berücksichtigt werden. Denn offensichtlich ist die kapitalistische Produktionsweise nicht nur durch die Anwendung technischer Arbeitsmittel oder Produktivkräfte im landläufigen bzw. engeren Sinne gegeben (d. h. durch die Maschinen, mit denen Güter hergestellt werden), sondern auch durch den Einsatz von Medien unterschiedlicher Art wie Uhren, Telekommunikationsnetzwerken oder Datenspeichern, nicht zuletzt aber durch die Angewiesenheit auf das allgemeine Medium Geld. Damit bietet sich der Analyse zugleich die Chance, einseitigen Auffassungen der jeweiligen Gegenstandsbereiche – also einem schlichten Ökonomismus oder Technizismus – zu entkommen und verkürzte Lesarten der Marx’schen Analyse des Kapitalismus einerseits und gängiger Medien- und Techniktheorien andererseits zu vermeiden. Das Heft soll einen Beitrag zur Diagnose des gegenwärtigen ‚digitalen‘ Kapitalismus liefern, indem die Arbeiten von Marx (aber auch Beiträge kritischer Theorietraditionen) vor dem Hintergrund neuer medien- und techniktheoretischer Ansätze und vice versa diskutiert werden.
Hier kann das Heft bestellt werden.